
„Es mangelt offensichtlich am politischen Willen, sich unserer Zukunft anzunehmen”
– Luisa Neubauer
Das Bündnis
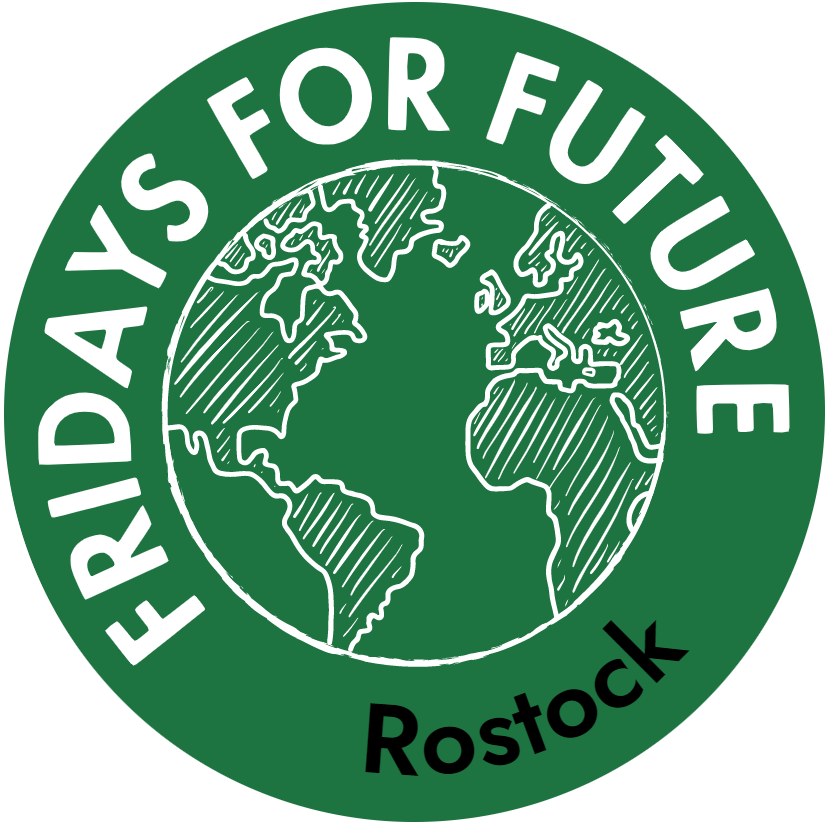
Fridays for Future
Schüler*innen aus Rostock und Umgebung, die als Teil der globalen FFF-Bewegung für wirksame Klimaschutz-maßnahmen demonstrieren.

Students for Future
Wir sind Studierende aus Rostock, die sich mit FFF solidarisieren und für Klimagerechtigkeit einstehen.

Parents for Future
Eltern, Freunde und engagierte Menschen stellen sich hinter FFF und deren Forderungen.

Health for Future
Wir sind Angehörige der Gesundheitsberufe.
Gesundheit braucht Klimaschutz - denn gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planenten.
Unsere Partner
Unsere Ziele sind klar gesteckt sowie unsere Bewegung unabhängig.
Doch niemand kämpft alleine, auch wir nicht. Daher kooperieren wir mit vielen gleichgesinnten Partnern, um unser gemeinsames Ziel – den Klimawandel zu stoppen – zu erreichen.
Ob der Projektraum des PWH, der inhaltlichen Beistand der Scientists oder die vielen Kleinspenden – vielen Dank für eure Unterstützung!














